

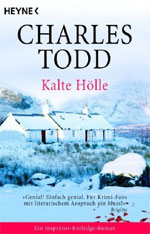
Kopieren oder produktiv weitergehen?
Aus Spielanordnung wird Geschichte
_________
Charles Todd: Kalte Hölle
Aus dem Amerikanischen von Uschi Gnade
Gute alte Rätselkrimis
Der gute alte englische Rätselkrimi ist ein Kind des ersten Weltkriegs. Während Agatha Christie in einer Krankenstation arbeitete und ihr Ehemann als Pilot focht, entwarf sie Hercule Poirot, den Meisterdetektiv. Mit ihrem Erstling The Mysterious Affair at Styles (Das fehlende Glied in der Kette), das 1920 erschien, begann das „Goldene Zeitalter“ des britischen Kriminalromans. (Es endete nach allgemeiner Übereinkunft 1945.) In unzähligen geschlossenen Gesellschaften, durch Wetter, Geografie und Klasse separiert vom Rest der arbeitenden Welt, wurden unzählige Menschen auf rätselhafte Weise umgebracht. Und jedes Mal erlag eine weltfluchtsüchtige Leserschaft dem doppelten Trugschluss, sie dürfe teilnehmen an der Lösung eines Kreuzworträtsels und das durch logische Deduktion. Doch seit wann braucht man für die Lösung von Kreuzworträtseln logisches Denken?
Scheinprobleme
Die Logik spielt weder bei Arthur Conan Doyle noch bei Agatha Christie ein große Rolle: Ihr angebliches Versprechen an den Leser, er könne, setze er nur die eigenen grauen Zellen so raffiniert ein wie der große Hercule, ist schlichter Lug. Ihre Plots strotzen vor Trug-Schlüssen, und die Rede vom Kreuzworträtsel passt eigentlich nur auf die Tüftelei des Autors, der seine Zeichensysteme und Buchstabenketten solange quält, bis sie in ein Rechteck und zueinander passen, egal ob sie einen Sinn ergeben oder nicht. Jochen Schmidt, elder critic der Zunft, hat in seiner hoffentlich bald wieder in neuer Fassung zugänglichen Typengeschichte des Kriminalromans deshalb lakonisch über diese "nach immer derselben Masche fast maschinell gehäkelten" Krimis bemerkt: "Der Leser ... erkennt die sorgsam zurechtgeschminkten Probleme als das, was sie in Wahrheit sind: als Scheinprobleme."
Kopieren oder produktiv weitergehen?
Trotzdem – oder vielmehr gerade deswegen — ist der Rätselkrimi
eine suchterzeugende Droge. Autoren lockt er als Spiel mit einer begrenzten
Zahl von Elementen und hoher Variabilität. Leser erhoffen sich bizarre
Einfälle und Mordmethoden und delektieren sich an der einzigen Gleichheit,
die auf der Welt zu haben ist: Am Verdacht, dass jeder der Mörder
sein könnte, ob Butler oder Lord.
Diese Sucht verleitet oft zu meisterschülerhaft ausgeführten Kopien des Häkelmusters. Halb peinlich, halb possierlich führt dies Gilbert Adair im gerade erschienen Mord auf ffolkes Manor vor.
Ernster zu nehmen als dieses Kunsthandwerk und Schnörkelspiel sind
da die Romane von Charles Todd um Inspektor Ian Rutledge. Von Todd berichtet
der Verlag im Vorspann zu seinem jüngsten Roman Kalte Hölle
nur, er lebe in London. Das verleiht dem Autor ein willkommenes Flair
von Tweed und Meerschaumpfeife. In Wirklichkeit handelt es sich bei »Todd«
um ein Autorenduo amerikanischer Ostküsten-Provenienz, aparterweise
aus Mutter Caroline und Sohn Charles. Wie die Amerikanerinnen Elizabeth
George oder Martha Grimes sind sie vernarrt ins Britische.
Aus Spielanordnung wird Geschichte
Todds Figur Ian Rutledge ist ebenfalls ein Kind des Ersten Weltkrieges.
Im törichter Unterwerfung unter das angeblich unerbittliche Kriegsrecht
hatte der Inspektor als kommandierender Offizier einen tapferen jungen
Schotten hingerichtet, der sich noch etlichen gescheiterten Angriffen
weigerte, erneut sinnlos auf den Feind loszustürmen. Jetzt sitzt
dieser Hamish in Rutledges Kopf und flüstert auf ihn ein. Mal als
despotischer Quälgeist, (in Die zweite Stimme von
1996) mal als einfühlsamer Dr. Watson, wie jetzt, sechs Romane weiter,
in Kalte Hölle.
Die Ausgangslage scheint ganz Häkelkrimi: In einem abgelegenen, durch Schneesturm beinahe unzugänglichen Dorf der Yorkshire-Dales ist kurz nach Kriegsende eine Bauernfamilie erschlagen worden. Nur ein kleiner Junge konnte in den Wintersturm fliehen. Rutledge, von der überforderten lokalen Polizei hinzugerufen, wirft sich in die fieberhafte Suche. Lebt der Junge noch? Ist er Zeuge oder ist er sogar der Mörder? Das behauptet jedenfalls sein leiblicher Vater. Der war als vermisster Soldat gegen Kriegsende für tot erklärt worden. Seine vermeintliche Witwe hatte eine neue Familie gegründet. Verdacht bedeutet im abgeschiedenen Urskdale Bedrohung der Existenz. Der Druck, der auf Rutledge lastet, ist keine Spielanordnung, sondern nackter Zwang: Wird der Junge nicht gefunden, wird ein Unschuldiger hingerichtet. Die erbarmungslose Härte der Landschaft, die von Not und Krieg traumatisierten Charaktere, sind eindringlich, fesselnd und psychologisch glaubhaft geschildert. Todds Figuren kämpfen nicht mit Scheinproblemen.
Unredigiertes Manuskript, Veröffentlichung in DIE ZEIT Nr. 32 vom 3.8.2006 