

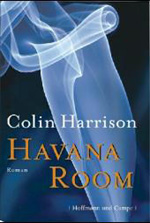
______
Colin Harrison: Havana
Room.
Aus dem Amerikanischen von Sepp Leeb
Mit Colin Harrisons Thriller Havana Room kehren
alte Werte wieder
Es fällt einem schon schwer, mit Bill Wyeth kein
Mitleid zu empfinden. Der Mann besaß alles, was ein guter Amerikaner
braucht – und sogar ein bisschen mehr. Und das hat er in einer einzigen
Nacht verloren. Bill erzählt uns seine Geschichte selbst, er will,
dass wir nicht nur seinen Sturz nachvollziehen können, sondern auch
die Höhe, aus der er gefallen ist. Deshalb rechnet der Immobilien-
und Geldanlagespezialist penibel vor, was sein gehobener Lebensstil in
Manhattan gekostet hat. Dem Kindermädchen hat er 48.000 Dollar gezahlt,
„das sind 100.000 vor Steuern.“ Die Hypothek für das
Apartment am Central Park belief sich auf 8790, die Wohnkosten betrugen
3945 Dollar im Monat, die Garage 585 und die private Krankenversicherung
2165 Dollar. All das kann Bill sich nicht mehr leisten, weil er ein Kind
getötet hat.
Ein Glas Milch zuviel
Was ihm passiert ist, könnte jedem geschehen.
Eines Nachts kommt er von einer Geschäftsreise nach Hause und gibt
einem der Jungen, die nach der Geburtstagsfete seines Sohnes bei ihm übernachten,
ein Glas Milch. Von dem Thai-Essen, das er sich zuvor noch hatte kommen
lassen, ist etwas Erdnußbutter an seiner Hand kleben geblieben.
Am Morgen ist der Junge tot, im anaphylaktischen Schock erstickt: Erdnußallergie.
Bills Pech: Der Vater des Jungen ist einer der mächtigsten Magnaten
Manhattans. Seine Rache ist gründlich. Bill wird aus der noblen Anwaltskanzlei
gefeuert, in der er das viele Geld verdient hat, und niemand will mehr
etwas mit dem Kindsmörder zu tun haben. Ehefrau Judith („mit
vierunddreißig hatten ihre Brüste immer noch Marktwert“)
wechselt zu einem New-Economy-Tycoon nach Kalifornien. Auch zu Sohn Timothy
reißt der Kontakt ab. Bill verkriecht sich in einer billigen Absteige
und leckt deprimiert, arbeitslos und einsam seine Wunden. Irgendwann begreift
er, dass er auch vor seinem Absturz ein Niemand war. „Meine Identität
erwies sich als genauso austauschbar wie einer der maßgeschneiderten
Anzüge, die ich einmal getragen hatte, und ich muss gestehen, dass
ich, während ich zusah, wie Stück um Stück meines Lebens
davonflatterte – Job, Ehe, Kind, Zuhause, Geld, Freunde –
einer perversen Neugier frönte, was bleiben könnte.“
Ein New Yorker Jedermann
Das Bild, das Colin Harrison von diesem zeitgenössischen New Yorker
Jedermann Bill Wyeth entwirft, ist - ironisch eingefärbt zwar, aber
doch altbekannt aus der moralischen Traktatliteratur - das des reichen
Mannes, der in der Brust kein Herz, sondern einen Geldbeutel hat. Das
Schicksal hat ihn zu Boden geworfen, nun folgt die Zeit der Bewährung.
Zuflucht findet der Ausgestoßene in einem Steakhouse im südlichen
Manhattan. Als Stammgast läßt er sich täglich an Tisch
17 nieder und findet seine innere Ruhe bei der Beobachtung der tafelnden
Geschäftswelt wieder, zu der er nicht mehr gehört. Die Zeit
seiner Buße beginnt, als Wyeth der attraktiven Restaurantgeschäftsführerin
zu Liebe einem Mann bei der Abwicklung eines Immobiliengeschäfts
zur Seite steht. Er aktiviert den Restposten seiner bürgerlichen
Existenz, seine Kenntnisse als Anwalt, um nur all zu bald in eine Welt
einzutauchen, in der die Spielregeln von Haß und Gewalt bestimmt
werden. Symbol dieser anderen Welt ist der Havana Room
im Keller des Restaurants, zu dem nur ausgewählte Gäste Zutritt
haben, um dort geheimen Lüsten und Ritualen zu frönen.
Eine tiefgefrorene Leiche
Ehe er sich versieht, erliegt Wyeth dem jungenhaften
Charme seines Mandanten Rainey und steckt mitten in einem Kriminalfall.
Die Entdeckung einer gefrorenen Leiche auf dem Inselgrundstück am
Meer ist nur der Beginn eines sich immer wilder drehenden Strudels aus
Verfolgungen, Beschattungen und Schlägereien. Wyeth und sein sympathischer,
jedoch gehetzt und krank wirkender, wie unter Zwang handelnder Geschäftsfreund
geraten ins Visier eines dubiosen südamerikanischen Winzers und werden
von den Schlägern eines fetten schwarzen Clubbesitzers verfolgt.
Das Ganze endet tödlich und mit dem Untergang des Havana Rooms und
seiner (hier natürlich nicht verratenen) Geheimnisse.
Bewiesene Vätersolidarität![]()
Bestünde die Geschichte nur aus diesem Immobiliengeschäft
und seinen Weiterungen im New Yorker Untergrund, wäre Havana
Room nicht mehr und nicht weniger als ein elegant geschriebener
Roman Noir, der durch die tragische Figur Raineys eine bemerkenswerte
existenzielle Tiefe gewinnt. Doch damit wollte Harrison sich offenkundig
nicht zufrieden geben und hat deshalb ein Happy End angestückelt.
Erstaunlicherweise kommt Wyeth nicht nur mit dem Leben davon. Treu hat
er zu seinem Mandanten gehalten, der, wie sich herausstellt, letztlich
darauf aus war, sich mit seiner Familie zu versöhnen. Wie zur Belohnung
für die erwiesene Vätersolidarität erhält Wyeth aus
heiterem Himmel die Gattin und – noch wichtiger - den schmerzlich
vermißten Sohn aus Kalifornien zurück, als wäre nichts
geschehen.
Diese willkürliche Wendung macht aus Havana Room
ein Stück zeitgenössische Erziehungsliteratur. Die Lehre, die
der in seinem männlichen Selbstbild verunsicherte Leser aus dieser
Schreckenserzählung in guter puritanischer Tradition ziehen soll,
lautet: Liebe Deine Familie mehr als Deinen Job, sonst bestraft dich das
Chaos. Mit diesem pädagogischen Subtext steht Harrison keineswegs
allein da. In Harlan Cobens Thriller Keine
zweite Chance, der gerade als Neuzugang auf der Krimibestenliste
gelandet ist, bewährt sich ebenfalls ein Vater im Kampf um sein verschwundenes
kleines Mädchen. Hier und in Havana Room zeichnet
sich eine neue moralische Dimension ab. Zurück zu den „family
values“ lautet seine Botschaft. Wer seine Familie nicht liebt, den
bestraft das Leben.
Unredigiertes Manuskript, Veröffentlichung in
Die
Welt vom 28.5.2005 ![]()