

Glückliche Simplizität des Eises
Kalte Helden, von Frauen umschwärmt
Neue Helden: Handwerker des Überlebens
Der neue Stil des Sehens und Gehens
_______
Thomas Kastura: Flucht ins Eis. Warum wir ans kalte Ende der Welt wollen.
William Laird McKinlay: Karluk. Die Geschichte einer verratenen Expedition.
Aus dem Englischen von Günter Seib
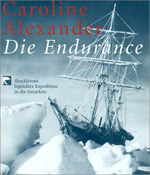
Caroline Alexander:
Die Endurance. Shackletons legendäre Expedition in die Antarktis.
A.d.Amerikanischen von Bruno Elster

Diana Preston: In den eisigen Tod. Robert F. Scotts letzte Fahrt zum Südpol.
Aus dem Englischen von Sylvia Höfer
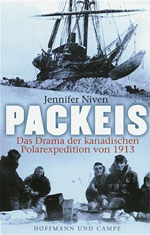
Jennifer Niven:
Packeis. Das Drama der kandischen Polarexpedition von 1913.
Aus dem Amerikanischen von Sabine Schulte
Edmund Blair-Bolles: Eiszeit.
Wie ein Professor, ein Politiker und ein Dichter das ewige Eis entdeckten.
A.d. Amerikanischen v. Astrid Becker
Louis Beyens:
Arktische Passionen.
Ein Reisebericht.
Aus dem Niederländischen von Janneke Panders
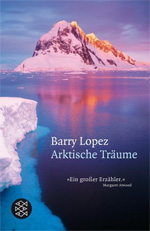
Barry Lopez:
Arktische Träume.
Aus dem Amerikanischen von Ilse Strasmann
Frank Hurley:
Die Schicksalfahrt der Endurance.
Mit Shackleton in die Antarktis.
A.d. Englischen von Ruth Sander
Alfred Lansing:
635 Tage im Eis.
Die Shackleton-Expedition.
A.d. Amerikanischen von Franca Fritz, Heinrich Knoop, Kristian Lutze
Alan Gurney:
Der weiße Kontinent.
Die Geschichte der Antarktis und ihrer Entdecker.
A.d. Englischen v. Michael Benthack
Arktis — Antarktis.
Hrsg.: Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Ausstellungskatalog
Lesen als Kannibalismus: Warum wir uns so gerne Polarabenteuer einverleiben
Immer kracht das Eis. „Um das Schiff herum erstreckte sich in alle Himmelsrichtungen bis an den Horizont ein Meer aus Eis, weiß und geheimnisvoll unter dem sternenklaren Firmament.“ „Die Kraft von zehn Millionen Tonnen Eis drückte gegen die Bordwände. Und es schrie im Todeskampf.“ Die Zitate sind verschiedenen Büchern entnommen, doch ist es immer dieselbe Geschichte: Männer bewähren sich im einsamen Kampf gegen das Eis der Pole.
In dieser Geschichte, die immer und immer wieder mit wechselnden Besetzungen und gleichem Ablauf erzählt wird, muss ein Faszinosum enthalten sein. Warum folgen wir immer wieder dieser kleinen Gruppe von Männern in das Eis, zerren ihre Schlitten mit, verlieren das Gefühl in den erfrorenen Extremitäten, versinken in Todesschlaf? Warum klettern wir immer wieder lesend in ihre stinkenden, vereisten Schiffe? Warum können wir die Ohren nicht vor dem Ächzen des Eises verschließen, das unser Schiff „wie eine Nussschale“ (immer wie eine Nussschale!) zerknackt? Warum tun wir uns das an?
Glückliche Simplizität des Eises
Eine Frage, die jemandem wie Arved Fuchs bei jedem Vortragsabend gestellt wird. Trotzdem weiß der Berufsabenteurer, der 1989 innerhalb eines Jahres beide Pole zu Fuß erreichte, keine befriedigende Antwort. Angesichts der Strapazen, die er überstanden hat, klingt seine einfach zu simpel: „Ich unternehme Expeditionen, weil sie mir positive Lebenseindrücke vermitteln – und nicht, weil ich eine masochistische Ader in mir verspüre.“ Noch einfacher formuliert es die Isländerin Sigga, die ihn bei seiner letzten Tour durch das südliche Eismeer begleitete: „Man lebt so unglaublich intensiv. Man lebt selbst – und lässt nicht leben.“
Geradezu verärgert reagiert Thomas Kastura auf die intellektuelle Schlichtheit der Polreisenden. „Da steht er nun, der Goretex-Tor, und ist so klug als wie zuvor“, mokiert er sich über Fuchs’ Gestammel nach Erreichen des Südpols 1989. Und setzt noch eins drauf: „Große Gedanken werden an den Erdachsen gemeinhin nicht gedacht.“ Die diversen wissenschaftlichen Erklärungen, die er selber in seinem elegant und kenntnisreich formulierten Essay Flucht ins Eis zusammengetragen hat, führen jedoch erstaunlicherweise auch nicht weiter. Sie bestärken nur die Vorannahme des gesunden Menschenverstands, dass es sich bei den Abenteurern um Leute abseits der Norm handelt: auf der Flucht vor den Widrigkeiten des Alltags, mit denen manche nicht fertig werden können, stürzen sie sich in halsbrecherische Abenteuer, die sie in den von Psychologen Flow genannten Zustand versetzen. „Ohne viel Nachdenken verschmelzen dann Bewusstsein und Handlung zu einer zeitenthobenen Einheit“ formuliert Kastura. Für ihn läuft das Ganze letztlich auf Ich- und Zeitflucht hinaus: „Das lästige Ich lässt sich nur dann loswerden, wenn man einen Teil der Persönlichkeit ausblendet. Angst gehört dazu, Reflexionsfähigkeit und nicht selten der gesunde Menschenverstand.“
Nun, und was wäre, wenn der Reiz dieser Abenteuer gerade darin bestünde, diesen omnipotenten und zugleich wirkungsohnmächtigen Aufklärungsverstand des zentralheizungsgeschützten Sesselhockers außen vor zu lassen und einfach herauszufinden, was in einem steckt? Für Abenteurer wie Fuchs oder Messner trifft dies allemal zu, sie betonen es ja immer wieder. Aber sehnen sich nicht auch die Leser danach, mit Scott oder Shackleton oder einem bisher kaum bekannten Helden wie William McKinlay ein paar Stunden aus der Unübersichtlichkeit ihres Alltags dorthin zu flüchten?
Das wäre die einfache Erklärung: Polar- und Berg-Bücher versetzen ihre Leser in eine extreme Welt, in der nur noch die menschlichen Ressourcen zählen, die der Einzelne mobilisieren kann. Je kälter, einsamer, zivilisationsferner der Schauplatz – desto deutlicher tritt hervor, worin die letzte Kraft besteht, über die wir verfügen.
Betrachtet man den Zivilisationsalltag unter diesem Gesichtspunkt, leben wir ungleich gefährdeter als jene fünf Engländer, die auf ihren Schlitten einen Haufen Steine und zu wenig Brennmaterial 1911/12 zum Südpol schleppten. Scott & Co hätten nur, wie der besonnenere Shackleton vier Jahre früher, rechtzeitig umkehren müssen, um zu überleben. Wir Zivilisationsmenschen sind doch völlig hilflos, wenn nur eines unserer komplexen Lebenserhaltungssysteme beschädigt wird: ein Computervirus, drei Tage lang ungewöhnlich viel Schnee – und schon erfrieren wir mitten in unseren sicheren Städten. Wir besitzen kaum eine Möglichkeit, über unser persönliches Leben oder Sterben zu entscheiden.
Die Helden der Polarliteratur hatten diese Möglichkeit - wie Scotts Gefährte Oates, der eines Morgens das Zelt verließ und im Schneesturm verschwand, weil er das Vorankommen der anderen nicht mehr behindern wollte. Auch wer hierin keine Sternstunde der Menschheit (wie seinerzeit Stefan Zweig) zu erkennen vermag, wird sich dem Gefühlssturm, den die Vergegenwärtigung dieser Szene auslöst, schwerlich entziehen können.
Das Menschenmögliche 
„Übermenschlich“ werden leichthin die Anstrengungen genannt, mit denen sich die schwachen Menschlein der überwältigenden Natur entgegenstellten. Bezeichnenderweise beherrscht ein Motiv die Bucheinbände: das eingefrorene Schiff. Das Schiff im Eis markiert den äußersten Verlust an Heimat. Zugleich symbolisiert es den Triumph menschlicher Überlebenskraft: das Heim wurde aufgegeben, seine Bewohner zogen dennoch weiter ins kalte Nichts. Nicht die Übermenschlichkeit dieser Taten ist es, die fasziniert, sondern ihre Menschenmöglichkeit. Und die Berichte, die wir lesen, zeugen davon, dass dies Menschen möglich war, die manchmal sogar nicht viel besser trainiert und vorbreitet waren als wir.
Eine dieser Geschichten handelt von der Karluk. William McKinlay erzählte sie 1976, fast ein Leben nach jenem Juli 1913, in dem er als putzjunger Meteorologe den Walfänger Karluk bestiegen hatte, um im Polarmeer die letzten weißen Flecken für Kanada zu entdecken. Die vom Start weg desorganisierte Expedition endete im Desaster. Elf Menschen kamen um. Mangelhaft versorgt und unzureichend ausgestattet, blieb die Karluk auf halbem Wege im Packeis stecken. Als sich herausstellte, dass sie wie andere Katastrophen-Schiffe vor ihr, statt nach Osten vorzudringen, nach Westen treiben würde, setzte der eitle Expeditionsleiter Vilhjalmur Stefansson sich ab. Von den übrig gebliebenen 25 Personen an Bord hatten nur vier Weiße und eine Eskimofamilie Polarerfahrung. Nachdem die Karluk vom Packeis zerdrückt war, retteten sich die Überlebenden auf die Wrangelinsel nördlich von Sibirien, wo sie überwinterten, während der Kapitän mit einem Eskimo 1200 km weit marschierte, um Hilfe zu holen. Obwohl McKinlay seine Erinnerungen erklärtermaßen mit der Absicht publizierte, das öffentliche Bild Stefanssons zurechtzurücken, hat er einen durch Wahrhaftigkeit ungemein überzeugenden Bericht ihres Überlebenskampfes geschrieben. McKinlay ist nicht nur einer der wenigen, der die lebenserhaltende Rolle der Eskimos auf Polfahrten wie dieser richtig darstellt. In anrührenden Worten vermag er auch, die seltenen Schönheiten der Arktis plastisch zu schildern – ihr Anblick munterte ihn immer wieder auf, wenn seine Kräfte versagten oder die Notgemeinschaft der Schiffbrüchigen gänzlich auseinander zu fallen drohte.
Von diesem, 1999 wieder auf deutsch erschienenen Kleinod der Polarliteratur geht trotz der schweren Vorwürfe gegen die Expeditionsleitung eine versöhnliche Stimmung aus. Man hätte den bedächtigen, bescheidenen und sensiblen Mckinlay gern zum Freund – ein Gefühl, das Egozentriker wie Scott oder Rabauken wie Amundsen schwerlich wecken können. Am Beispiel McKinlays fällt es deshalb besonders leicht, dem Faszinosum Polarliteratur noch einen Schritt näher zu kommen. Es geht um das Heldentum der Helden, die uns ihren Bann ziehen.
Symbolischer Kannibalismus
In Masse und Macht beschreibt Elias Canetti, dass wir das für unsere Sicherheit so notwendige Gefühl der Unverletzlichkeit auf zwei möglichen Wegen zu gewinnen suchen: Der eine ist, sich durch Rüstung und Technologie die Gefahr vom verletzlichen, weichen Leib zu halten, der andere ist Heldentum. Indem der Held sich der Gefahr, sei sie ein Gegner oder eine Eiswüste, aussetzt und sie bezwingt, beweist er sich – und seinen Bewunderern – seine Unverletzlichkeit. Indem er immer größere Gefahren überwindet, kann das Gefühl der Unbesiegbarkeit sich steigern zur „Sucht des Überlebens“. Ein spezifischer Ausdruck dieser Überlebenssucht ist für Canetti der rituelle Kannibalismus. Indem der Sieger sich Teile des Unterlegenen einverleibt, eignet er sich respektvoll dessen Kraft an und wird dadurch stärker.
Die eigenartige verbreitete Sucht auf Eisliteratur nun, die selbst einen Aufklärer wie Kastura eingestandenermaßen quält, könnte man, Canettis Überlegungen übertragend, als eine Art von symbolischem Kannibalismus verstehen. Der Leser stärkt sich lesend und nachkämpfend an den Überlebenskräften seiner Helden, nicht zuletzt im stolzen Bewusstsein eigener Lebendigkeit.
Übrigens kommt es bei dieser Art symbolischer Heldenverzehrung nicht so sehr darauf an, ob die Vorbilder überlebt haben oder umgekommen sind. Bei gegebener dramatischer Grundkonstellation – minimal bewaffneter Mensch contra allertödlichste, allermenschenfeindlichste Natur – entscheidet der Zeitgeist, welche Gestalt die Energien annehmen, die in die Literatur eingespeist werden. Jede Zeit gewinnt einen anderen Geschmack an Heroen, die den Schrecken des Eises und der Finsternis trotzten.
Kalte Helden, von Frauen umschwärmt
Manchmal sind es auch nur Bilder, die neue Helden aus dem Meer der Bücher auftauchen lassen. Zu den editorisch ergiebigen Merkwürdigkeiten der so genannten „heroischen“ Polarexpeditionen zwischen 1890 und 1915 gehört, dass sie zwar in größter Einsamkeit verliefen – Funk war noch nicht möglich – aber sowohl durch die Aufzeichnungen der Teilnehmer als auch bereits durch Film und Fotografie sehr gut dokumentiert sind. Schließlich handelte es sich um Forschungsexpeditionen, selbst wenn, wie im Falle Scotts, Pearys, Amundsens oder Stefanssons nationale und persönliche Ruhmsucht dominierten.
Zur Sensation wurden 1998 die wiederentdeckten und restaurierten Fotografien der bis dahin kaum beachteten Endurance- Expedition. Nie zuvor war der Kampf mit dem Eis so brillant zu sehen gewesen wie auf den Bildern des Expeditionsfotografen Frank Hurley. Das Ausstellungsbuch der Kuratorin Caroline Alexander wurde zum Verkaufsschlager. Die deutsche Ausgabe stand 1999 vier Monate lang auf den Bestsellerlisten, wurde mehr als 50.000 mal verkauft und löste die reinste Shackleton-Mania aus, die diesen Herbst ihren Niederschlag allein in sieben weiteren Shackleton-Expeditionsberichten findet, zu denen noch Arved Fuchs’ Bericht einer Nachreise auf seinen Spuren kommt.
Bemerkenswert ist, dass die Abenteuer der kalten Helden gegenwärtig besonders das Interesse von Frauen wecken. Caroline Alexander ist nicht allein geblieben. Eine weitere Version von Scotts letzter Fahrt zum Südpol hat jetzt die englische Historikerin Diana Preston aus den Dokumentenmassen geborgen. Und die amerikanische Drehbuchautorin Jennifer Niven wärmt auf 450 Seiten die Geschichte der Karluk wieder auf.
Im Nachwort zu ihrem – sachlich nur wenig ergiebigen Buch – offenbart Preston, dass in ihrer Highschool ein Zitat von Scott hing: „Hätten wir überlebt, hätte ich eine Geschichte zu erzählen gehabt, die das Herz jedes Engländers gerührt hätte.“ Prestons Geschichte ist vor allem dazu angetan, das Herz der weiblichen Engländer zu rühren. Der einzige eigenständige Akzent, den sie bei der Wiedererzählung der nationalen Scott-Legende setzt, zielt darauf, den Helden etwas psychologisches Profil zu geben: Scott wird als verträumtes Kind geschildert, das sich (und im Abschiedsbrief noch seinen Sohn) zu übersteigerter Härte anhielt; dezent weist sie auf homoerotische Motive hin, die bei der Auswahl von Expeditionsteilnehmern und im Zusammenleben eine Rolle gespielt haben könnten. Den krassen Fehlentscheidungen Scotts, die diese Gentlemanexpedition in eine Katastrophe verwandelten, hält sie den „Heroismus“ der Teilnehmer entgegen. Vermutlich ist es ein Rest pubertärer Identifikation mit ihrem Heros, dass Preston weder in der Beurteilung seiner Hauptkonkurrenten Shackleton und Amundsen, noch durch Einordnung dieses romantischen Selbstmordunternehmens in das soziale, kulturelle und politische Umfeld der Zeit über den Horizont Scotts zu blicken vermag.
Jennifer Niven macht sich anheischig, McKinlays Vermächtnis zu erfüllen, indem sie durch eine genauere Darstellung allen Menschen auf der Karluk Gerechtigkeit widerfahren lässt. Genauer heißt in diesem Fall vor allem umfangreicher: Tag für Tag rekapituliert sie die Eintragungen aller verfügbaren Tagebücher. Die einzige Erfahrung, die ein Kenner von McKinlays Bericht mit Nivens Buch machen kann, besteht in einer Art gruppentherapeutischer Supervision, länger als die Polarnacht. Nicht einmal über die zwiespältige Figur Vilhjalmur Stefanssons erfährt man substantiell Neues.
Neue Helden: Handwerker des Überlebens
Scott wurde zum Helden, weil er in der Krisenzeit um den 1. Weltkrieg gewissermaßen schattenlos den Idealen des britischen Gentleman-Soldatentums zu entsprechen schien. Während Scott heute skeptischer betrachtet wird (selbst Preston trägt ja etliches Material hierzu bei), rücken seine Gegner als Vorbilder in den Vordergrund. Wenn Arved Fuchs es als sein „handwerkliches Können“ bezeichnet, sich die Ziele so zu setzen, dass man sie erreichen und lebendig zurückkehren kann, entspricht das dem Vorgehen Amundsens. Im Unterschied zu Scott wusste er, wie man mit Schlittenhunden arbeitet, er konnte Ski laufen und hatte von den Eskimos Kleidung und Überlebenstechniken übernommen. Ähnlich Ernest Shackleton: Er war 1908 klug genug, umzukehren, obwohl er nur 100 Meilen vom Südpol entfernt war. Sein und seiner Leute Leben war ihm keinen Weltrekord wert. Ähnlich konsequent wagte er eine gefährlichsten Reisen der Seegeschichte, als er 1916 im offenen Rettungsboot 1300 Kilometer durch das Südpolarmeer segelte, um Hilfe für seine gestrandete Mannschaft zu holen.
Diese Reise hat Handwerker Fuchs im Frühjahr 2000 in einem baugleichen Rettungsboot wiederholt. Das Buch über diese auch heute noch extrem gefährliche Fahrt ist gerade durch den nachholenden Vergleich mit den Erfahrungen der Vorgänger eine spannende Hommage an Shackleton und seine Leute. Fuchs macht durch die plastische Schilderung der eigenen Beschwerlichkeiten deutlich, welch ungeheure physische und vor allem psychische Leistung die sechs Männer im kleinen Boot erbracht haben.
Ende der Schrecken des Eises und der Finsternis
Fuchs’ Fahrt und auch die zehn Jahre zuvor mit Reinhold Messner realisierte Antarktis-Durchquerung auf der von Shackleton 1914 geplanten Route markieren Wendepunkte. Historische Rekonstruktion und sportliche Ziele geben den Abenteurern neue Motive, auch wenn, wie Kastura spöttisch anmerkt, eine Roman-Idee von 1906 wohl nie verwirklicht werden wird: Mit dem Fahrrad zum Südpol.
Längst hat auch die Wirklichkeit der Polregionen kaum mehr etwas mit jenen Schrecken des Eises und der Finsternis zu tun, von denen bisher die Rede war. Als Fuchs und Messner am Südpol ankamen, prosteten ihnen Dutzende von Wissenschaftlern zu, die dort in riesigen Blechhütten hausen; auf dem Eis des Nordpolarmeeres driften Forschungsstationen ganzjährig im Kreis. Vielleicht ist die gegenwärtige Welle von Polarliteratur nicht mehr als der letzte Abgesang auf eine Erfahrung der Erde, wie sie nicht mehr möglich sein wird.
Wie schnell die Erdanschauungen wechseln, mag eine Erinnerung verdeutlichen. Erst vor rund 150 Jahren wurde durch Elisha Kanes Beschreibung der großen Grönlandgletscher die gerade mal zwanzig Jahre ältere Hypothese evident, es habe in der Erdgeschichte eine Eiszeit gegeben. Bis dahin gingen die Geologen davon aus, dass Gott seiner Schöpfung so etwas Katastrophales nicht antun könne, und selbst Kane hoffte 1857 noch gegen alle Anschauung, nördlich der Eisbarrieren werde sich ein wärmeres Meer auftun. Leider ist die spannende Wissenschafts-Geschichte über die Durchsetzung der Eiszeit-Theorie, die der amerikanische Wissenschaftsjournalist Edmund Blair Bolles erzählt, dank der Unsitte, jeden konzisen Gedanken in eine Reportage aufzulösen, und einer schandbaren Übersetzung kaum lesbar.
Der neue Stil des Sehens und Gehens
Wie eine neue unheroische Art des Erzählens von den Grenzregionen der Erde aussehen könnte, zeigen zwei Bücher auf gegensätzliche Weise. In beiden geht es darum, die Arktis nicht als Todeszone, sondern als komplexen Lebensraum zu beschreiben. Wie leider so oft ist das neue Buch das schlechtere. In Arktische Passionen (1997) hat der niederländische Biologe Beyens Reiseberichte und Feldprotokolle seiner Forschungen zu einem Arktis-Patchwork zusammengefasst. Vermutlich würde man das krude Nebeneinander von tödlichen Unfällen, Verdauungsproblemen und Pflanzenbeschreibungen als Erstlingsversuch hinnehmen, da Beyens außer weitgehend zufälligen Erlebnissen auch interessante Beobachtungen mitteilt. Aber dem steht der Vorläufer entgegen, und das ist das Meisterwerk.
Man müsste weit ausholen, um Landschaftserzählungen zu finden, die mit Barry Lopez’ Arktische Träume (erstmals 1986) vergleichbar sind – Humboldt fällt einem da ein oder Hamilton-Patersons Seestücke. Ausgehend von konkreten Erfahrungssituationen – Lichteinfall hinter einem Hügel, ein Spaziergang auf der Pingok-Insel – sondiert er in weiträumig komponierten Erzählungen (oder soll man sie Fakten-Symphonien nennen?) polare Lebenszusammenhänge, geht den komplizierten und oft auch noch wenig erforschten Beziehungen zwischen Wetter, Eis, Menschen, Tieren und Pflanzen nach. Lopez kennt nicht das dramatische Rein-Raus der Forscher und Abenteurer. Moderne Technologie erlaubte ihm, auch unter extremsten Außenbedingungen noch mehr zu tun als genau zu beobachten: ihm ist es gelungen, die Landschaft auf sich, auf seine Gefühle, Erinnerungen und sein Wissen wirken zu lassen. Und das vermag er zu beschreiben! Wie kaum ein anderer Autor verbindet er genaueste Sachkunde mit immenser Belesenheit und einem schwebend-exakten Stil, mit dem er auch kleinste Nuancen zu erfassen vermag. Ob er über die Lebensweise der Eisbären und Moschusochsen, über Wanderungsbewegungen von Pflanzen, Tieren und Menschen oder über das Licht und das Eis schreibt – Lopez löst das Versprechen ein, der Landschaft ihre „Würde“ schreibend wiederzugeben. Das ist kein esoterischer Schmalz, kein plattes Öko-Gedusel. Lopez lehrt uns, die Arktis zu verstehen. Das mentale Eis bricht.
Unredigiertes Manuskript, veröffentlicht in LITERATUREN 12/2000