

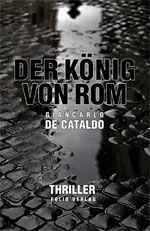
Schlecht denken, böse Fragen stellen
____
Giancarlo de Cataldo
Der König von Rom
Italien, erzählt in seinen Verbrechen
Von Tobias Gohlis und Giancarlo de Cataldo
Für die deutschen Leser, denen vierzig Jahre italienische Geschichte nicht unmittelbar präsent sind, haben der Autor Giancarlo de Cataldo und Tobias Gohlis gemeinsam ein Nachwort zum Roman Der König von Rom verfasst. Das Nachwort und die angehängte Zeittafel vergegenwärtigen den historischen Rahmen, die Gemengelage zwischen Staat, Politik und Verbrechen, die den Romanen de Cataldos zugrunde liegen. Der König von Rom erzählt die Geschichte vor der Geschichte: Wie Libanese, der Anführer der späteren Magliana-Bande, seine ersten tastenden Schritte auf dem Weg des großen Verbrechens tut und dabei in Versuchung gerät, sich mit einer Tochter der Bourgeoisie aus dem Staub zu machen. De Cataldo und Gohlis haben ihre - durch unterschiedliche Schrift kenntlichen Texte - zu einer gemeinsamen Collage zusammengefügt. Die Zeittafel wurde von Tobias Gohlis erstellt.
Ein Treffen![]()
Im Herbst 2012 ist Giancarlo de Cataldo zufällig einem der Bosse der
Maglianabande wieder begegnet. Und der alt gewordene Gangster hat
sich beschwert: "Während ich im Gefängnis saß, haben Sie sich damit
vergnügt, einen Roman über eine Bande zu schreiben, die es nie gegeben
hat. Denn unsere Aktionen waren Einzelaktionen und rein ‚individueller'
Natur."
Ein starkes Stück. Denn genau dieser Eindruck – dass es sich bei den
Drogenverbrechen, Morden, Erpressungen, Grundstücksschwindeleien,
Raubüberfällen der 1970er- und 1980er-Jahre um Taten Einzelner handelte
– war der Schutzschild gewesen, hinter dem sich die Maglianabande
hatte verbergen können. Nur wenige, im Apparat isolierte Polizisten hatten
hinter den verschiedenen Verbrechen das Muster und die organisierenden
Hirne erkannt. Diesen Beamten hat de Cataldo später in der Figur
des Dr. Nicola Scialoja ein Denkmal gesetzt.
Doch bevor er Romanzo Criminale schreiben konnte, den Roman,
der die Geschichte der Maglianabande und damit Roms und Italiens zwischen
1977 und 1992 erzählt, musste sich der Autor den Stoff erst einmal
erschließen. Das war alles andere als ein Vergnügen. Er arbeitete damals
als Richter am römischen Schwurgericht. Seine Chance kam, als ihn
sein Chef ansprach.
"Mein lieber de Cataldo, das Verfahren gegen die Maglianabande
muss eröffnet werden. Glauben Sie, Sie schaffen das?"
"Es war der 20. September 1995. Ich war 39. Ich willigte sofort ein.
Vierzehn Tage später begann in der historischen Fechtschule von Luigi
Moretti der Prozess gegen die mächtigste und berüchtigtste kriminelle
Organisation Roms."
De Cataldo erinnert sich, dass sich seine Kollegen nicht darum rissen,
dieses Verfahren zu übernehmen. Bandenkriminalität galt nicht als
prestigeträchtig und somit nicht der Karriere förderlich. Zudem gab es
Befürchtungen um die persönliche Sicherheit. Auch de Cataldo musste
erst seine Frau, selbst eine erfolgreiche Anwältin, davon überzeugen, dass
ihm und der Familie keine Gefahr drohte. Immerhin lagen die Attentate
auf die Antimafia-Richter Giovanni Falcone und Paolo Borsellino erst
drei Jahre zurück. Schließlich dauerte der Prozess kürzer als befürchtet
und endete mit rund 500 Jahren Gefängnis für die 69 Angeklagten, 17
wurden freigesprochen.
Auf dem Weg zum Romanzo![]()
"Ich entschied mich als Autor dafür, diesen Prozess zu übernehmen, nicht
als Richter", betont Giancarlo de Cataldo. Denn hier hatte er den Stoff
gefunden, nach dem er immer schon gesucht hatte. Er ist als Sohn eines
Lehrerpaars 1956 in Taranto geboren, einer uralten Hafenstadt in Apulien.
Da es dort keine Universität gibt, musste er nach dem Abitur 1974
nach Rom ziehen.
"Jeder Sohn aus dem Süden muss einen akademischen Abschluss machen.
Ich wollte Filmregisseur werden, aber damals herrschte an der
Filmakademie Aufnahmestopp. Also studierte ich Jura, wie alle, denen
nichts Besseres einfällt", erinnert er sich. Mitte der 1970er-Jahre gab es
nur den staatlichen Rundfunk in Italien. Der gescheiterte Filmregisseur
beteiligte sich mit Leidenschaft an den ersten privaten Rundfunksendern
und hatte bald seine tägliche Talksendung über kulturelle Themen. Während
de Cataldo jeden Nachmittag über Kino, Bücher und Musik
sprach, lieferten sich vor der Tür Linke und Rechte Straßenschlachten.
Nicht nur die Roten Brigaden übten den bewaffneten Kampf, auch die
Neofaschisten. Uniformiert waren beide: Die einen mit Jeans, Parka und
langen Haaren, die anderen trugen Lederjacken, Stiefel und Glatze. Rom,
die "offene Stadt" der Nachkriegszeit, war aufgeteilt in linke und rechte
Bezirke. Wehe dem, der im falschen unterwegs war. Es war die Zeit, in
der Kinder aus bürgerlichem Elternhaus links waren und im "Lumpenproletariat"
die revolutionäre Kraft sahen. Die Beziehung zwischen Giada
und Libanese in diesem Roman ruft die Sehnsüchte jener Tage in Erinnerung.
De Cataldo dazu: "Damals wollten Verbrecher wie Libanese normale
Bürger werden. Und die normalen Bürger liebäugelten damit, Verbrecher
zu sein oder zumindest wie sie zu handeln."
Nach Studium und Militärdienst bewarb er sich 1981 für das begehrte
Richteramt. Eine harte Prüfung: Von dreitausend Bewerbern wurden
hundert genommen. De Cataldo bestand und entschied sich für einen
Job, der unbeliebt war, der Arbeitsplatz jedoch in Rom und Umgebung lag, wo seine Frau arbeitete und wo die Kultur war. Fünf Jahre war er
Richter am Tribunale di Sorveglianza ("Überwachungsgericht") von Latium.
Diese Gerichte, zu denen es im deutschen Justizwesen keine genaue
Parallele gibt, entscheiden in allen Fragen des Strafvollzugs, also über
Hafterleichterungen, Strafmaßnahmen, Resozialisierungsmaßnahmen usw.
Für de Cataldo war dies eine reiche Quelle der Erfahrung. Er lernte alle
Sorten von Verbrechern und alle Varianten von Lügen, aber auch die
Miseredes
Strafvollzugs kennen. Über diese Jahre veröffentlichte er 1991
eine Mischung aus Essay und Tatsachenbericht, den er in Erinnerung an
Adorno Minima Criminalia nannte.
Zuvor hatte er 1989 bereits den Kriminalroman Nero come il cuore ("Schwarz wie das Herz") veröffentlicht. Darin ging es um Organhandel
und Einwanderer. Der traurige Held war ein Anwalt und der Stil american
hardboiled. Weitere Krimis mit dem Ermittler Bruio, Erzählungen
und Essays, Drehbücher für TV-Serien folgten. Sie umkreisten die Themen
Nord und Süd, Justiz und Verbrechen. Und ab 1996 brütete er über
dem Material für den Romanzo Criminale, studierte Aussagen und Akten,
entwarf fünf Jahre lang Szenarien und Charakterskizzen. Im sechsten Jahr
schrieb er den Roman fertig. Er erschien 2002.
Romanzo Criminale![]()
In Romanzo Criminale erzählt de Cataldo fünfzehn Jahre italienischer
Geschichte aus einem besonderen Blickwinkel: Es ist der einer Gruppe
von römischen Vorstadtgangstern, die zur mächtigsten Bande Roms aufsteigen
und nach fünf Jahren in alle Winde zerstreut oder ermordet sind
oder im Gefängnis sitzen. Diese Maglianabande hat es einerseits wirklich
gegeben, und der Richter Giancarlo de Cataldo hat das Seine dazu beigetragen,
sie als Bande juristisch dingfest zu machen. Andererseits ist sie
durch seinen Roman und die darauf basierenden Verfilmungen durch
Michele Placido (2005) und Stefano Sollima (2008–2010) zu einem Mythos
geworden, der tief in die Herzen nicht nur der Römer, sondern aller
Italiener reicht. Romanzo Criminale erfüllt gleichzeitig die Funktionen eines
römischen Heimatromans, einer grandiosen Räuberromanze und eines
Politthrillers. Es gibt Webseiten, T-Shirts mit den Konterfeis der Banditen-
Darsteller und Stadtführungen zu den Schauplätzen der Filme. Es
gibt Filme, in denen behauptet wird, die Bande existiere immer noch
und beherrsche Rom aus dem Untergrund. Kurz, der Maglianabande ist
es ergangen wie jeder großen Verbrecherorganisation: Die Tatsachen werden
von Mythos und Fiktion überwuchert. Oder anders: Die Fiktion hat
ihre eigene Wirklichkeit geschaffen. Vor diesem Hintergrund klingt De
Cataldos Darstellung wie eine Beschwörung:
Der "Boss" hat Recht: Romanzo Criminale ist wirklich ein Roman. Auch
wenn er von einer wahren Geschichte ausgeht, ist Romanzo Criminale sicher
nicht die "wahre Geschichte der Maglianabande" – und hat dies zu keinem
Zeitpunkt sein wollen. Allen wiederkehrenden Polemiken über die Faszination
des Bösen und allen damit einhergehenden Spekulationen zum Trotz, Romanzo
Criminale ist keine Parteinahme für die Maglianabande, und wollte dies auch
niemals sein. Wenn überhaupt will der Roman ein Bild von der zerstörerischen
Macht der menschlichen Habgier zeichnen – und zwar ohne tröstlichen Ausgang.
All denen, die sich Libanese zum Vorbild nehmen wollen, gebe ich den
guten Rat, seine Geschichte bis zum bitteren Ende zu verfolgen.
Über die reale Maglianabande schreibt der Autor:
Bis in die frühen 1970er-Jahre war das Verbrechen in Rom eine Sache von
Fäusten und Messern, von Wucherern und eleganten Dämchen. Es herrschte
der gefürchtete Marseiller-Clan, unverfrorene, exzessive, leicht dekadente
Gangster. Sie waren die unangefochtenen Monopolisten des Drogenmarktes:
Damals – wie heute – war die Droge die absolute Königin der Szene-Lokale,
wo die römische Jugend gemeinsam mit bekannten Gesichtern aus dem
Show-Biz und verblassenden Sternchen der Halbwelt die letzten Züge einstiger
"Dolce-Vita"-Herrlichkeit in durchzechten Nächten einsog.
1975/76: Eine Gruppe von jungen und ehrgeizigen Kleinkriminellen in Rom
schickt sich an, eine Bande nach mafiösem Vorbild zu organisieren. Das war in
Rom zuvor noch nicht geschehen – und es sollte nachher auch nie mehr passieren.
Um in das einzig relevante Verbrechen, das Drogengeschäft, einzusteigen,
benötigten sie Startkapital. Von der verzweifelten Suche danach erzählt
Der König von Rom.
In der rauen Wirklichkeit wurde das Geld durch Entführung und
Mord beschafft. 1977 entführte der spätere Bandenchef Franco Giuseppucci
(im Roman Libanese genannt) den Grafen Grazioli. Trotz Lösegeldzahlung
durch die Familie wird er ermordet. Unterstützung findet
das junge Banden-Unternehmen bei angesehenen Gangstern wie Raffaele
Cutolo, der seit 1963 wegen Mordes im Gefängnis sitzt und von dort die
von ihm gegründete Nuova Camorra leitet, und dem Lokalmatador Nicolino
Selis (im Roman il Sardo). Einen anderen Lokalfürsten, Franco
Nicolini (im Roman Terribile), bringen sie bald um. Dazu de Cataldo:
Im Laufe weniger Jahre, zwischen 1977 und 1983, macht die Bande reinen
Tisch mit ihren Rivalen. Die zornigen jungen Löwen zwingen die regierenden
Paten zu Pakten. Wer sich widersetzt, wird aus dem Weg geräumt. Das
Territorium wird in Zonen eingeteilt. Die Gewinne aus den schmutzigen Geschäften
werden gleichmäßig aufgeteilt – nach dem Prinzip einer für alle, und
für die "Opfer der Justiz" werden Rücklagen gebildet. Keine kriminelle Aktion
entgeht der Kontrolle der Bande. Das "core business" ist der Drogenhandel.
Die Straßen von Rom sind von Heroin überflutet. Der Schuss nimmt den Platz
des Joints ein. Eine Redensart gibt das Lebensgefühl jener Zeit treffend wieder:
"In Magliana setzen sich selbst die Vögel einen Schuss" – was nichts anderes
heißt, als dass die Droge von einem Spielzeug gelangweilter Reicher zur sozialen
Geisel geworden ist. Die Bande hat die Art des Verbrechens von Grund auf
verändert: Das Gangstertum hat dem organisierten Verbrechen Platz gemacht.
Dynamik, Aggressivität, Modernität kennzeichnen die Wachstumszyklen nicht
nur des gesellschaftlichen Fortschritts, sondern auch der dunklen Seite unserer
Zeit. Während die repressiven Staatsapparate konvulsiv mit dem Kampf gegen
den Terrorismus beschäftigt sind, wird die Bande aufgrund der eisernen Kontrolle
des Territoriums und ihres weitreichenden Feuerradius
von zunehmendem
Interesse für andere. Es werden Geschäftsbeziehungen
zu Mafia, Camorra,
chinesischen und südamerikanischen Drogenhändlern aufgebaut. Neofaschistische
Terroristen oder Terroristenaspiranten
nehmen Kontakt mit Bossen oder
Unterbossen der Bande auf. Zutritt zu dieser Gemeinschaft zu bekommen, ist
eine Ehre.
Die Bande macht gemeinsame Sache mit geheimen Bruderschaften und
"fehlgeleiteten" Abteilungen der Geheimdienste. Es folgen Leistungen und Gegenleistungen,
Gefälligkeiten und die später wieder rückgängig gemachte Bitte,
das Verlies Aldo Moros zu suchen, und andere Dinge, die noch nicht gänzlich
aufgeklärt wurden und wohl auch nie aufgeklärt werden.
Der 1916 geborene Aldo Moro war mehrfach Ministerpräsident gewesen
und einer der angesehensten Politiker der Democrazia Cristiana (DC),
deren Präsident er war. Moro wurde 1978 auf dem Weg zum Parlament
von den Roten Brigaden entführt. Dort sollte an diesem Tag die Minderheitsregierung
des DC-Politikers Giulio Andreotti durch ein Vertrauensvotum
fast aller Parteien unterstützt werden. Auch die Kommunisten
(PCI), damals zweitstärkste Partei, wollten Andreotti im Sinne des von
Moro favorisierten "Historischen Kompromisses" unterstützen. Die PCI
hatte sich unter Führung Enrico Berlinguers zuvor von Moskau losgesagt.
Die genauen Umstände und Hintergründe der Entführung und Ermordung Moros, der nach 55 Tagen erschossen im Kofferraum eines Autos
im Zentrum von Rom aufgefunden wurde, sind nicht restlos geklärt.
Der Historische Kompromiss der beiden ursprünglich im Antifaschismus
der Nachkriegszeit verwurzelten Parteien bedrohte die "Logik
der Konferenz von Jalta". So sah es der Journalist Carmine Pecorelli, der
wegen der intensiven Recherchen zur Ermordung Moros 1979 selbst
umgebracht wurde. (Dafür wurden 2002 Ex-Ministerpräsident Andreotti
und der Mafiaboss Gaetano Badalamenti in erster Instanz verurteilt,
in zweiter allerdings freigesprochen.) In Jalta hatten USA und UdSSR
ihre jeweiligen Hegemonialsphären gegeneinander abgegrenzt. Der
Wechsel Italiens, das als Frontstaat galt wie sonst nur die BRD, zu einer
neutralen oder weniger antikommunistischen Regierung hätte aus der
Sicht der Hardliner innerhalb der CIA und aller möglichen postfaschistischen
Gruppierungen in Italien dieses Gleichgewicht der Kräfte gestört.
Die Ermordung Moros durch die Roten Brigaden, die mit der
Entführung vorgeblich nur ein paar ihrer politischen Gefangenen freibekommen
wollten, wurde durch die Weigerung der Andreotti-Regierung,
mit den Entführern zu verhandeln, provoziert, lag aber im Interesse aller,
denen an der Aufrechterhaltung des Status quo gelegen war. Dazu
gehörten neben den USA auch die UdSSR, beide nahmen über ihre Geheimdienste
auf die unmittelbar Beteiligten, die Roten Brigaden auf der
einen und verschiedene neofaschistische Kräfte auf der anderen Seite,
Einfluss.
Zum Terror der Roten Brigaden gesellten sich ebenfalls in den
1970er-Jahren eine Reihe von Anschlägen neofaschistischer Gruppierungen
wie des Ordine Nuovo und der Nuclei Armati Rivoluzionari (NAR).
Hinter diesen standen die geheime Freimaurerloge Propaganda Due (P2)
und die von der CIA geführte paramilitärische Guerilla-Organisation
Gladio, deren Existenz (praktisch in allen westlichen Frontstaaten des
Kalten Krieges) erst in den 1990er-Jahren aufgedeckt wurde.
Als Repräsentanten für diesen mehr oder minder undurchschaubaren,
dennoch vorhandenen Komplex schattenstaatlicher Aktivitäten hat
Giancarlo de Cataldo die Figur des Vecchio, des Alten, erfunden. Er charakterisiert
ihn als unscheinbaren Mann im Hintergrund, der (ähnlich
wie der Dekaden überstehende FBI-Chef J. E. Hoover) auf einem Berg
von Akten sitzt, mit dem er jeden erpressen kann. Vecchio ist ein Mann
ohne Ideologie, ein Anarchist, der die Geschehnisse ihren Lauf nehmen
lässt. Dieser geheime "Brückenkopf des eingefleischten Antikommunismus"
nutzt Linke wie Rechte, Homos und Heteros und eben auch die
aufstiegssüchtigen Jungs von der Maglianabande. Und zeigt diesen Königen der Straße, wenn nötig, die wahre Macht. De Cataldo hat ihn aus einem
Gedankenspiel geschaffen.
In den achtziger Jahren dachte der ehemalige Staatspräsident Sandro Pertini,
der linke wie der rechte Terrorismus werde von einem geheimen Zentrum
gesteuert, von den Sowjets, den Amerikanern oder beiden. Er nannte es symbolisch
"Il Vecchio", und ich habe es personifiziert.
Und dann, gerade als die Bande an die Spitze des kriminellen Italiens vorgestoßen ist, beginnt auch schon der abrupte, aber unaufhaltsame Fall. Es gibt ein Gesetz, das die Unterwelt regiert und das keine Ausnahme kennt. Kein Verbrecher, der nicht ein großer Verbrecher, ein Boss sein will. Und kein Boss, der nicht davon träumt, ein normaler, "sauberer Mensch" zu werden, in seinem eigenen Bett, im Kreise seiner Familie, seiner Kinder und Kindeskinder zu sterben, ohne Angst vor dem Gefängnis oder vor der tödlichen Kugel, die seiner unglückseligen Existenz ein Ende setzt. Es ist logisch: Um ein großer Verbrecher zu werden, musst du die Nummer eins der Straße werden, doch um "normal" zu werden, musst du der Straße wieder den Rücken kehren – und genau in diesem Moment kehrt dir die Straße den Rücken. Es wird jemand kommen, der noch unnachgiebiger, noch grausamer, gewalttätiger und hungriger sein wird als du. Und der wird deinen Platz einnehmen – auf die einzig mögliche Art und Weise: indem er dich wegfegt. So hat es mit der Maglianabande geendet.
Schmutzige Hände![]()
Romanzo Criminale umfasst die Jahre 1977 bis 1992, der nachfolgende
Politthriller Schmutzige Hände von 2007 den Zeitraum von 1992 bis
1994. Damit umspannt de Cataldo die zwei Jahrzehnte, in denen das
politische System der Nachkriegszeit zusammenbrach, bzw. die Erste Republik.
Am Ende von Schmutzige Hände stehen die Wahlrechtsreform
von 1994, der Untergang der drei zuvor tragenden Parteien DC, PCI
und PSI (Sozialistische Partei) sowie der Aufstieg neuer populistischer
Gruppierungen und Silvio Berlusconis.
In Schmutzige Hände wechselt der Autor die Perspektive. Nicht mehr
die lokalgeschichtlichen Aktivitäten einer römischen Verbrecherbande,
sondern Machtverschiebungen innerhalb des Staatsapparats, repräsentiert
im Kampf zweier Staatsdiener, Geheimnisträger und Agenten gegeneinander,
bilden den Fokus des Geschehens. Stalin Rossetti und Nicola Scialoja
kämpfen nicht nur um das böse Erbe Vecchios, sondern auch um Patrizia,
die ehemalige Hure, die bereits in Romanzo Criminale im Zentrum
der erotischen Obsessionen stand. Rossetti ist der bad cop, Scialoja nicht
der gute, sondern nur der lesser bad cop. Rossetti war und ist sowohl für
die geheimste Geheimorganisation Catena, als auch im Dienst der Mafia
als Killer unterwegs. Scialoja ist Vecchios Erbe und an die Spitze der geheimen
Operationen getreten. Als solcher unternimmt er den Versuch,
mit der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, zu einem Agreement zu
kommen – ein Vorhaben, das er niemals eingestehen dürfte.
Um diesen Handlungskern herum, der auf ein schlichtes Wer-Gegen-Wen hinausläuft, trudeln die Großereignisse jener Jahre. Giancarlo De
Cataldo:
1989 fällt die Berliner Mauer. Wenige Monate danach ändert die italienische
kommunistische Partei (PCI) ihren Namen in PDS (Partito Democratico
della Sinistra / Demokratische Partei der Linken) um.
Nachdem die Vorbehalte aus dem Kalten Krieg nichtig geworden sind,
kann Italien durchaus eine Linksregierung haben. Darum müssen mit der Mafia
keine Geschäfte mehr gemacht werden, um sie als antikommunistische Kraft
einzusetzen.
Am 30. Januar 1992 verurteilt das Kassationsgericht Mafiabosse zu lebenslangen
Haftstrafen. Die Bosse, die noch in Freiheit sind, beschließen, sich
an den Politikern zu rächen, die sie nicht geschützt haben.
Im März 1992 teilt ein Gefängnisinsasse den Carabinieri Folgendes mit:
Achtung, es wird Anschläge und Attentate geben. Die Mafia ist wütend, aber
nicht nur sie allein wird agieren. Es gibt einen Plan, Italien zu destabilisieren und
eine neue politische Kraft zu schaffen, die Italien in den nächsten Jahren regieren
wird.
Wenige Tage darauf wird Salvo Lima, ein hoher Politiker der Christdemokraten
ermordet. Lima war der Garant für das Gleichgewicht zwischen Staat
und Mafia in Sizilien.
Erneut befragen die Carabinieri den Häftling und sammeln neue Aussagen.
Informationen über diese Befragungen sickern durch und werden in den Medien
veröffentlicht. Zwei Tage lang wird die Gefahr eines drohenden Staatsstreichs
heraufbeschworen, bis sich jemand daran erinnert, dass der Häftling
bereits wegen Verleumdung verurteilt worden war. Seine Aussagen werden als
Ente abgetan.
In der Zwischenzeit: Am 23. Mai 1992 werden der Richter Giovanni Falcone
und zwei Monate später der Richter Paolo Borsellino buchstäblich in die
Luft gejagt. Im September wird Ignazio Salvo ermordet, ein mächtiger "Gabelliere",
Freund der Mafia, jener Mann, der in Sizilien im Auftrag des Staates die
Steuern einhob und dafür einen großen Anteil für sich behielt.
Gleichzeitig beginnen in Mailand die Erhebungen gegen die politische Korruption.
Im Laufe zweier Jahre (1992–1994) werden die beiden wichtigsten Regierungsparteien,
die Christdemokraten und die Sozialisten, durch die Untersuchungen
der Richter von "mani pulite" ("saubere Hände") aufgerieben.
1993 legt die Mafia Bomben in Florenz, Mailand und Rom. Es ist der Versuch,
den Staat zum Verhandeln zu zwingen. Der Staat weiß nicht, was er tun
soll. Es gibt Kontakte (hierzu laufen heute noch Untersuchungen) zwischen Polizei,
Carabinieri, geheimen Diensten und der Mafia.
Alle diese Ereignisse durchziehen Schmutzige Hände. Es ist, wie de Cataldo
sagt, eine Hypothese. Aber, so meint er im Interview:
Verschwörungen hat es gegeben. Ich nenne sie Catena, die Figur des
Vecchio
hat diese Geheimorganisation gegründet.
Nach dem Ende des Kalten Krieges wurde bekannt, dass es eine solche
Organisation gegeben hat, sie wurde Anello – "der Ring" – oder auch Noto servizio
– "der wohlbekannte Service" – genannt.
Ein Beispiel: 1996 stieß die Polizei auf der Suche nach Dokumenten über
das Bombenattentat in Brescia von 1975 auf ein Gebäude in Rom. In dessen
Keller fand man mehr als eine Million Dokumente über Geheimdienstaktivitäten.
Ein Spezialist identifizierte die Dokumente, die irgendjemand dort hinterlegt hatte,
als Dokumente des Noto servizio. Sie wurden analysiert, für geheim erklärt
und, obwohl zu befürchten war, dass sie Auskunft über Verbrechen gaben, die
unter dem Geheimdienstsiegel begangen wurden, nicht komplett vernichtet,
sondern nur ein Teil davon. Der Grund war, so sehe ich es, man wollte diese
Akten für Situationen bewahren, in denen sie nützlich sein könnten. Das war
das Italien jener Zeit.
Zeit der Wut![]()
Den Roman Zeit der Wut hat de Cataldo gemeinsam mit dem in Italien
sehr bekannten Drehbuchautor Mimmo Rafele (u. a. Allein gegen die Mafia)
zunächst als Drehbuch konzipiert. Die beiden kennen sich von der
Arbeit an der TV-Serie Borsellino über den gleichnamigen Antimafia-
Richter. Der deutsche Titel Zeit der Wut bezieht sich auf den jungen Helden
des Romans, den Polizisten Marco Ferri. Er ist geladen mit einer Art
genetischer Wut, die ihn nur zu leicht aus dem Lager des rechtsstaatlich
agierenden Polizisten Nicola Lupo in das des Quasi-Söldners Aldo Mastino
überlaufen lässt, der in Wirklichkeit Befehlsempfänger des dämonischen
Kommandanten ist.
Der italienische Titel des Romans La forma della paura ("Die Gestalt
der Angst") kennzeichnet deutlicher als der deutsche das zentrale Thema.
An die Stelle der "Strategie der Spannung" aus der Zeit des Kalten Krieges
ist nach den Anschlägen des 11. September 2001 das Herrschaftsinstrument
der Furcht getreten. De Cataldo:
Seitdem herrscht eine diffuse Stimmung, wir müssten uns verteidigen, der
Westen befinde sich in einer Wagenburg: Wir treten in die Epoche der Selbstverteidigung
ein. Unser gemeinsamer großer Feind seien die Araber. Und ein
Haufen Geld wurde für Sicherheit ausgegeben. In Italien hat sich diese allgemeine
Bedrohungsangst verknüpft mit der Frucht vor Einwanderern, nicht nur
aus Nordafrika, sondern vor allem auch aus Osteuropa.
Die Dualität böser Cop – weniger böser Cop, die er bereits in Schmutzige
Hände erprobt hat, ist gewissermaßen ummantelt durch die zentrale böse
Figur des Kommandanten einerseits und die Intrige des vorgetäuschten islamistischen
Attentats andererseits. Die beiden Cop-Figuren agieren die
moralischen, politischen und Rivalitäts-Konflikte zweier Staatsdiener mit
unterschiedlichen Temperamenten und Idealen aus und bieten Identifikationsfläche
für den Diskurs über wehrhafte versus offene Demokratie. Dieser
findet jedoch nicht im luftleeren bzw. genre-gegebenen fiktiven Raum statt.
Denn sowohl dem Kommandanten als Typ ist der Autor in der Realität
begegnet als auch den illegal operierenden Polizisten, die friedliche
muslimische Einwanderer zu Anschlägen aufhetzen. Letzteren ist er im
Saal des Appellationsgerichtshofes begegnet, an dem er tätig ist. Giancarlo
de Cataldo:
Wir hatten den Fall zweier arabischer Fischer. Sie waren angeklagt, einen
Sprengstoffanschlag gegen den Soldatenfriedhof von Nettuno nahe Rom geplant
zu haben. Wir ließen sie frei, weil wir den Beweis hatten, dass jemand anderes
den Sprengstoff hinterlegt hatte.
Ein Geheimdienstler hatte diesen legalen arabischen Einwanderern gedroht,
er werde sie den Israelis oder der CIA ausliefern, wenn sie nicht kollaborierten.
Er wollte sie als Agenten in islamischen Kreisen einsetzen (wie den
Ägypter Salah im Roman). Diese sehr armen und kaum des Lesensund
Schreibens kundigen Fischer hatten einen italienischen Freund, der zum Islam
übergetreten war und dem sie deshalb vertrauten. Dieser Freund, ein Steinmetz,
folgte dem Geheimagenten beim nächsten Treffen und identifizierte ihn,
so dass wir ihn vor Gericht laden und befragen konnten.
In einem andern Fall wurden 14 oder 15 Nordafrikaner angeklagt, sie wollten
angeblich das römische Wasser vergiften. Ihre Telefone waren überwacht
worden. Man hatte den arabischen Gruß "scha nur", was so viel bedeutet wie
"Das Licht sei mit dir", mit dem italienischen Wort für Zyankali
– "cianuro" – verwechselt.
Das Vorbild für den Kommandanten, der einen Anschlag vortäuscht, um einen Konflikt zu verschärfen, war der amerikanische Spindoktor, Geheimdienstmann und spätere Krimischriftsteller Steve Pieczenik. Er hatte den italienischen Staat als Spezialist für psychologische Kriegsführung zur Zeit der Moro-Entführung beraten. Um zu verhindern, dass Moro freigelassen wurde, ließ er ein Schreiben der Roten Brigaden fälschen, das die Ermittler just zu dem Zeitpunkt, wo man Moro hätte finden können, von Rom weg an einen See in den Albaner Bergen lockte.
Schlecht denken, böse Fragen stellen![]()
Giancarlo de Cataldo und Mimmo Rafele haben Zeit der Wut als Appell
verstanden, sich gegen die Einschränkung demokratischer Freiheiten zu
wehren, die unter dem Vorwand, sie zu schützen, vollzogen wird.
De Cataldo sieht sich als Richter wie als Schriftsteller in einer Front
demokratischer Abwehr.
Als Richter ist er stolz auf die Unabhängigkeit (übrigens auch im Unterschied
zu den deutschen Staatsanwaltschaften, die den Justizministern
unterstehen), mit der die italienischen Gerichte und Ermittlungsbehörden
den Filz zwischen organisiertem Verbrechen und Geheimdiensten
untersuchen können und untersucht haben. "Wir wissen so viel, weil wir
so gute Richter haben! Und wir haben ein viel distanzierteres Verhältnis als ihr Deutschen zum Staatsapparat." Und tatsächlich wäre die Befragung
eines Geheimdienstbeamten, wie im Fall der arabischen Fischer, in
Deutschland wohl am Aussagevorbehalt der übergeordneten Behörde gescheitert.
In Italien hingegen muss ein Geheimdienstler als Zeuge auftreten,
mit allen Konsequenzen im Fall einer Falschaussage.
Als Kriminalschriftsteller, der mit Der König von Rom jetzt eine Tetralogie
der jüngsten italienischen Geschichte in ihren Verbrechen vorgelegt
hat, sieht sich Giancarlo de Cataldo zunächst einmal in einer Linie mit
seinen italienischen Kollegen. Er selbst hat sie als Herausgeber von Anthologien
und TV-Serien immer wieder zusammengeholt, um jeder auf
seine Weise vom Verbrechen, das heißt von Ungleichheit, Unterdrückung,
Ungerechtigkeit und Gewalt, zu erzählen. "Das große Verbrechen
unserer Zeit ist das Verbrechen gegen die Demokratie", fasst er zusammen,
"in dieser Zeit der Konfusion können wir auch den Guten nicht
vollständig trauen." Skepsis zu wecken, lebenswichtiges demokratisches
Misstrauen, das ist sein erklärtes Ziel. Oder, um es mit den Worten seines
Freundes Carlo Lucarelli zu sagen, sie üben sich in der Kunst, "schlecht
zu denken".
Und deshalb sieht de Cataldo sich in einer größeren Gemeinschaft
als nur der italienischen Autoren. Es ist die Internationale der demokratischen
Kriminalschriftsteller. "Nehmen Sie meine Bücher oder die von
Stieg Larsson, von Dominique Manotti oder Ian Rankin, dann sehen Sie:
Wir schreiben alle ganz verschieden, aber über das eine zentrale Thema,
unsere schwache, anfällige, fragile Demokratie und wer sie gefährdet."
Nachwort zu dem Roman Der König von Rom
Siehe auch: Tobias
Gohlis über Giancarlo de Cataldo: Romanzo Criminale
Siehe auch: Tobias
Gohlis über Giancarlo de Cataldo: Schmutzige Hände
Siehe auch: Portrait Giancarlo de Cataldo: "Wir können den Guten nicht vollständig trauen"
![]()